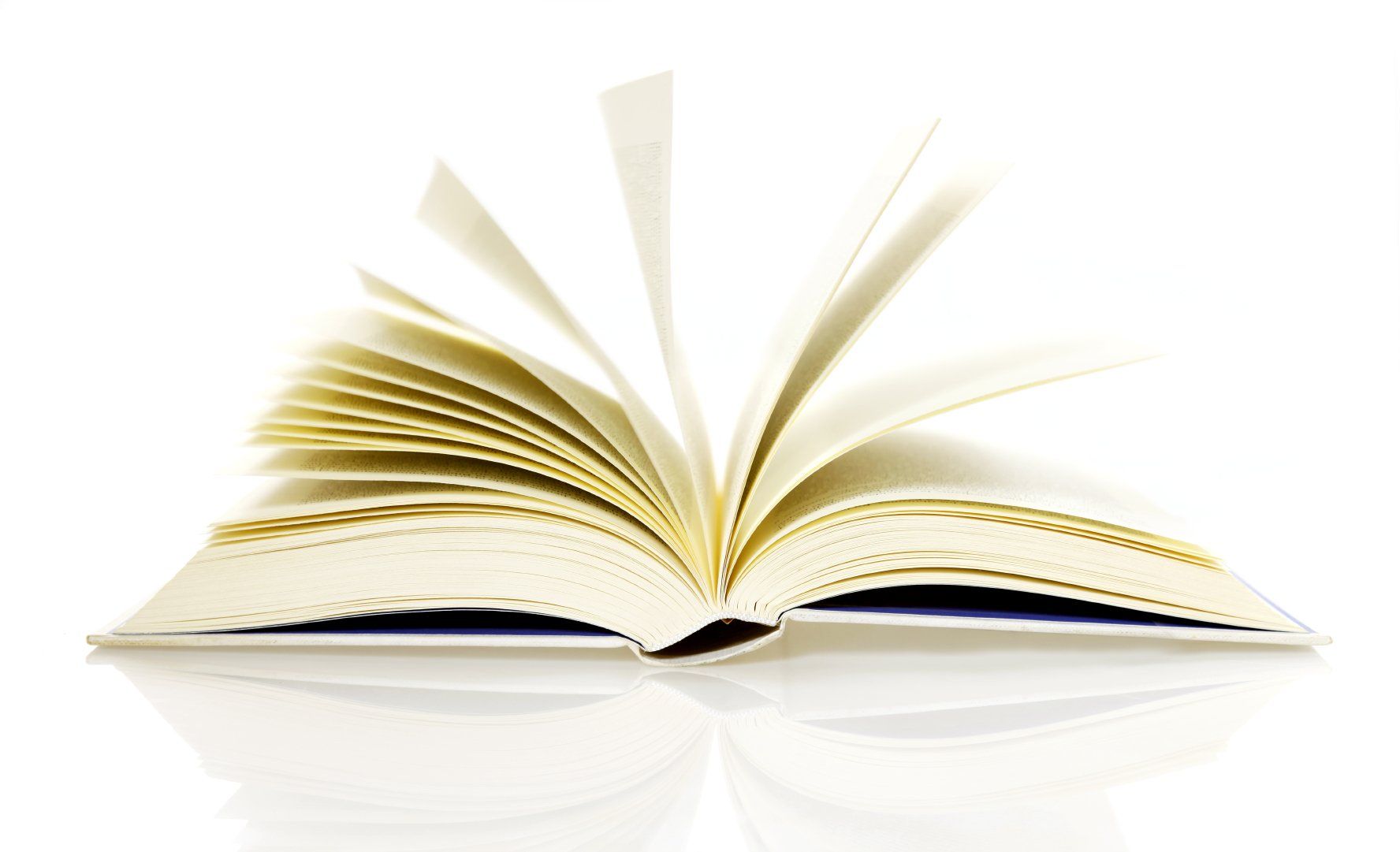Systemische Beratung, Therapie und Supervision
Systemische Beratung, Therapie und Supervision
Was ist systemisch?
Was ist systemisch?
Systemische Beratung bezeichnet die Beratung von Individuen oder Gruppen in Bezug auf deren jeweiliges soziales System im jeweiligen Kontext. Systemische Beratung befasst sich entweder mit Organisationsberatung oder mit der Beratung hinsichtlich des Familienkontextes. Systemische Beratung beruft sich auf Systemtheorie, Konstruktivismus und Kybernetik zweiter Ordnung.[1]
Bei der systemischen Beratung geht es primär um das Stärken der Ressourcen und Kompetenzen des zu beratenden Individuums bzw. der zu beratenden Gruppe und seines/ihres sozialen Systems. Zur Betonung dieser Vorgehensweise wird die systemische Beratung häufig auch als „ressourcenorientierte Beratung“ bzw. „lösungsorientierte Beratung“ bezeichnet. Im Unterschied zum inhaltsorientierten klassischen Beratungsansatz der Expertenberatung ist die systemische Beratung überwiegend prozessorientiert.[2]
Weitere systemische Beratungssettings sind:
Systemische Therapie
Systemische Organisationsberatung
Systemische Führung
Systemisches Coaching
Systemische Supervision
Die Grenzen zwischen systemischer Beratung und Therapie sind fließend.[3]
Systemische Therapie
Systemische Organisationsberatung
Systemische Führung
Systemisches Coaching
Systemische Supervision
Die Grenzen zwischen systemischer Beratung und Therapie sind fließend.[3]
Systemische Therapie
Systemische Therapie
Familientherapie - Systemische Therapie
Anders als bei anderen Therapieformen gibt es keine "Mutter" und keinen "Vater" der Familientherapie. Familientherapie gleicht einem Strom, zu dem von Anfang an eine Reihe innovativer ForscherInnen und TherapeutInnen beigetragen haben, teils ganz unabhängig voneinander, teils im Austausch miteinander.
Die Entwicklung der Familientherapie
Die Bewegung entwickelte sich in den fünfziger Jahren in den USA und in den sechziger Jahren in Europa, hier besonders in Deutschland und in Italien. Eine der zentralen Feststellungen war, dass auffälliges, "verrücktes" Verhalten keineswegs nur als Ausdruck innerseelischer Konflikte verstehbar ist, sondern als eine passende Reaktion im Zusammenhang mit den Umweltbedingungen, beispielsweise mit der Familienstruktur. Der therapeutische Blick erweiterte sich vom Individuum auf die Beziehung, die Zweierbeziehung, die Familie und größere Bezugssysteme. In den USA waren u. a. Gregory Bateson, Paul Watzlawick, Virginia Satir und Salvador Minuchin Wegbereiter, in Deutschland Horst-Eberhard Richter und Helm Stierlin und in Italien Mara Selvini Palazolli.
Was ist Familientherapie / Systemische Therapie?
In der Familientherapie / Systemischen Therapie werden Probleme nicht als Eigenschaften einzelner Personen gesehen. Sie sind Ausdruck der aktuellen Kommunikations- und Beziehungsbedingungen in einem System. Symptome erscheinen auch nützlich, da sie auf Störungen der Entwicklungsmöglichkeiten hinweisen.
Familientherapie / Systemische Therapie ist eine Form der Therapie, die Gesundheit und Krankheit, insgesamt die Lebensqualität von Menschen im Zusammenhang mit ihren relevanten Beziehungen und Lebenskonzepten sieht. Dabei erweiterte sich in den letzten Jahren der Blickwinkel von der Familie auf die sie umgebenden Systeme wie Arbeitsfeld und Wohnwelt und auch auf die Kontexte, in denen Therapie und Beratung stattfindet.
In der Familientherapie / Systemischen Therapie werden Probleme nicht als Eigenschaften einzelner Personen gesehen. Sie sind Ausdruck der aktuellen Kommunikations- und Beziehungsbedingungen in einem System. Symptome erscheinen auch nützlich, da sie auf Störungen der Entwicklungsmöglichkeiten hinweisen.
Familientherapie / Systemische Therapie ist eine Form der Therapie, die Gesundheit und Krankheit, insgesamt die Lebensqualität von Menschen im Zusammenhang mit ihren relevanten Beziehungen und Lebenskonzepten sieht. Dabei erweiterte sich in den letzten Jahren der Blickwinkel von der Familie auf die sie umgebenden Systeme wie Arbeitsfeld und Wohnwelt und auch auf die Kontexte, in denen Therapie und Beratung stattfindet.
Was hat Systemische Therapie / Familientherapie als Ziel?
Ziel der Therapie ist eine Erweiterung der Wahrnehmungs- und Handlungsmöglichkeiten des/der Einzelnen und des Gesamtfamiliensystems. FamilientherapeutInnen arbeiten ressourcenorientiert. Der Therapeut / die Therapeutin versucht, die bisherigen Muster und Vorannahmen in Frage zu stellen und regt andere Sichtweisen an, um neue Interpretationsvarianten und Interaktionsregeln zu ermöglichen. Dabei nutzt sie/er besondere Gesprächstechniken, beispielsweise das Umdeuten als die Kunst, etwas "in einen anderen Rahmen zu stellen", oder zirkuläre Fragen, durch die Menschen angeregt werden, ihre eigenen handlungsleitenden Annahmen über Beziehungen und ihre Einschätzungen der Motive und Prämissen der anderen auszusprechen und damit zur Diskussion zu stellen. Um Beziehungen erfahrbar zu machen, kann der Therapeut / die Therapeutin die Familien auffordern, sich in einer Skulptur darzustellen. Wahrnehmungen und Bewertungen können auch verändert werden durch den Gebrauch von Bildern und Metaphern.
Die TherapeutInnen sehen sich nicht als die Experten, die die Diagnose stellen und die Lösung vorgeben. Sie führen vielmehr einen neugierigen und respektvollen Dialog mit ihren KlientInnen, einem Einzelnen, einem Paar oder einer Familie, um sie darin zu unterstützen, Blockaden in ihrer Entwicklungsdynamik aufzulösen und neue Perspektiven und befriedigendere Muster des Zusammenlebens zu entwickeln.
Ziel der Therapie ist eine Erweiterung der Wahrnehmungs- und Handlungsmöglichkeiten des/der Einzelnen und des Gesamtfamiliensystems. FamilientherapeutInnen arbeiten ressourcenorientiert. Der Therapeut / die Therapeutin versucht, die bisherigen Muster und Vorannahmen in Frage zu stellen und regt andere Sichtweisen an, um neue Interpretationsvarianten und Interaktionsregeln zu ermöglichen. Dabei nutzt sie/er besondere Gesprächstechniken, beispielsweise das Umdeuten als die Kunst, etwas "in einen anderen Rahmen zu stellen", oder zirkuläre Fragen, durch die Menschen angeregt werden, ihre eigenen handlungsleitenden Annahmen über Beziehungen und ihre Einschätzungen der Motive und Prämissen der anderen auszusprechen und damit zur Diskussion zu stellen. Um Beziehungen erfahrbar zu machen, kann der Therapeut / die Therapeutin die Familien auffordern, sich in einer Skulptur darzustellen. Wahrnehmungen und Bewertungen können auch verändert werden durch den Gebrauch von Bildern und Metaphern.
Die TherapeutInnen sehen sich nicht als die Experten, die die Diagnose stellen und die Lösung vorgeben. Sie führen vielmehr einen neugierigen und respektvollen Dialog mit ihren KlientInnen, einem Einzelnen, einem Paar oder einer Familie, um sie darin zu unterstützen, Blockaden in ihrer Entwicklungsdynamik aufzulösen und neue Perspektiven und befriedigendere Muster des Zusammenlebens zu entwickeln.
(Anne Valler-Lichtenberg / DGSF)
Systemische Supervision
Supervision ist die Betrachtung und Reflexion professionellen Handelns und institutioneller Strukturen.
Systemische Supervision basiert auf den Prinzipien systemischen Denkens. Theoretische Grundlagen bilden u.a. die Kommunikationstheorie, die Kybernetik und die Systemtheorie.
Systemische Supervision ist immer kontextbezogen. Sie nimmt die Wechselwirkung zwischen Person, Rolle, Funktion, Auftrag und Organisation in den Blick. Ziel ist die Erweiterung der Denk- und Handlungsmöglichkeiten. Menschen werden als selbstverantwortlich handelnde Personen respektiert. Verhalten wird als nicht vorhersehbar, kontrollierbar und beliebig steuer- und veränderbar angesehen.
Systemische Supervision arbeitet sowohl auftragsbezogen als auch prozessorientiert. Sie findet in mit den SupervisandInnen als ExpertInnen ihrer Person und ihrer Arbeit und der SupervisorIn als UnterstützterIn der Außenperspektiven einem dialogischen Prozess statt. Durch das Einnehmen einer Außenperspektive auf individuelle, fachliche und institutionelle Fragen werden Interaktionen, Muster und Prozesse sichtbar. Unterschiede können wahrgenommen werden. Damit gelingt es zu erkennen, was verändert und was beibehalten werden kann und soll.
Systemische Supervision versucht den Blick auszuweiten auf Faktoren, die normalerweise nicht gesehen oder nicht gewertet werden, und ermöglicht damit neue Lösungen. Systemische Supervision arbeitet lösungs- und ressourcenorientiert. Die supervisorische Haltung ist allparteilich, kontextsensibel und beachtet die Genderperspektive. Reflexion und Lösungsorientierung erfolgt nicht linear; die systemische Supervisorin / der systemische Supervisor denkt vielmehr in Wechselseitigkeiten und in Wechselwirkungen.
Den systemischen SupervisorInnen steht ein breites Methodenrepertoire zur Verfügung. Neben sprachlichen Elementen kann auch mit kreativen Mitteln gearbeitet werden, die die Dinge häufig leichter und schneller "auf den Punkt" bringen. Zu den wichtigsten Supervisionsmethoden gehören Hypothesenbildung, Auftrags- und Kontextklärung, zirkuläre, ressourcen- und lösungsorientierte Fragen, Systemkommentare, Reframing, die Arbeit mit Skulpturen - sowohl mit Personen als auch mit Gegenständen - Organigramme, Genogramme und Lagepläne, Nutzen von Zeitlinien, von Nähe und Distanzen, Abbau von Barrieren, der Einsatz von Ritualen, Geschichten und Metaphern.
Supervisionskonzepte beziehen sich auf den Bereich der professionellen Arbeit und die Entwicklung von Einzelnen, Teams, Gruppen, Leitungen und Organisationen. Entsprechend findet Supervision in Form von Einzel- Gruppen- Team- und Leitungssupervision statt. Systemische Supervision wird heute in vielen Handlungsfeldern genutzt. Systemische Supervision findet in unterschiedlichen Kontexten statt, in psychosozialen, klinischen und pädagogischen Arbeitskontexten und zunehmend auch im betrieblichen Kontext. Auch im Bereich der beraterischen und therapeutischen Fort- und Weiterbildung spielt systemische Supervision - hier auch mit der Besonderheit der Live-Supervision - eine bedeutende Rolle.
(Anne Valler-Lichtenberg / DGSF)
Systemische Supervision basiert auf den Prinzipien systemischen Denkens. Theoretische Grundlagen bilden u.a. die Kommunikationstheorie, die Kybernetik und die Systemtheorie.
Systemische Supervision ist immer kontextbezogen. Sie nimmt die Wechselwirkung zwischen Person, Rolle, Funktion, Auftrag und Organisation in den Blick. Ziel ist die Erweiterung der Denk- und Handlungsmöglichkeiten. Menschen werden als selbstverantwortlich handelnde Personen respektiert. Verhalten wird als nicht vorhersehbar, kontrollierbar und beliebig steuer- und veränderbar angesehen.
Systemische Supervision arbeitet sowohl auftragsbezogen als auch prozessorientiert. Sie findet in mit den SupervisandInnen als ExpertInnen ihrer Person und ihrer Arbeit und der SupervisorIn als UnterstützterIn der Außenperspektiven einem dialogischen Prozess statt. Durch das Einnehmen einer Außenperspektive auf individuelle, fachliche und institutionelle Fragen werden Interaktionen, Muster und Prozesse sichtbar. Unterschiede können wahrgenommen werden. Damit gelingt es zu erkennen, was verändert und was beibehalten werden kann und soll.
Systemische Supervision versucht den Blick auszuweiten auf Faktoren, die normalerweise nicht gesehen oder nicht gewertet werden, und ermöglicht damit neue Lösungen. Systemische Supervision arbeitet lösungs- und ressourcenorientiert. Die supervisorische Haltung ist allparteilich, kontextsensibel und beachtet die Genderperspektive. Reflexion und Lösungsorientierung erfolgt nicht linear; die systemische Supervisorin / der systemische Supervisor denkt vielmehr in Wechselseitigkeiten und in Wechselwirkungen.
Den systemischen SupervisorInnen steht ein breites Methodenrepertoire zur Verfügung. Neben sprachlichen Elementen kann auch mit kreativen Mitteln gearbeitet werden, die die Dinge häufig leichter und schneller "auf den Punkt" bringen. Zu den wichtigsten Supervisionsmethoden gehören Hypothesenbildung, Auftrags- und Kontextklärung, zirkuläre, ressourcen- und lösungsorientierte Fragen, Systemkommentare, Reframing, die Arbeit mit Skulpturen - sowohl mit Personen als auch mit Gegenständen - Organigramme, Genogramme und Lagepläne, Nutzen von Zeitlinien, von Nähe und Distanzen, Abbau von Barrieren, der Einsatz von Ritualen, Geschichten und Metaphern.
Supervisionskonzepte beziehen sich auf den Bereich der professionellen Arbeit und die Entwicklung von Einzelnen, Teams, Gruppen, Leitungen und Organisationen. Entsprechend findet Supervision in Form von Einzel- Gruppen- Team- und Leitungssupervision statt. Systemische Supervision wird heute in vielen Handlungsfeldern genutzt. Systemische Supervision findet in unterschiedlichen Kontexten statt, in psychosozialen, klinischen und pädagogischen Arbeitskontexten und zunehmend auch im betrieblichen Kontext. Auch im Bereich der beraterischen und therapeutischen Fort- und Weiterbildung spielt systemische Supervision - hier auch mit der Besonderheit der Live-Supervision - eine bedeutende Rolle.
(Anne Valler-Lichtenberg / DGSF)
DGSF-Wissensportal systemisch.info
DGSF-Wissensportal systemisch.info